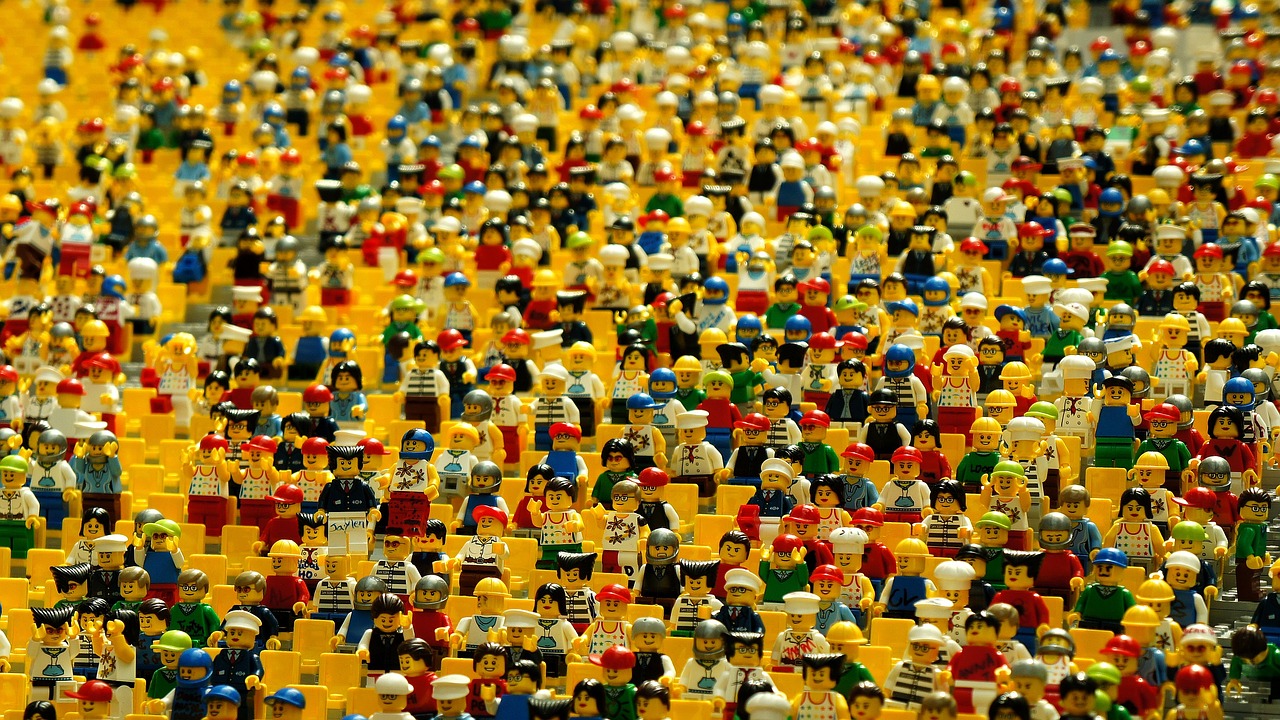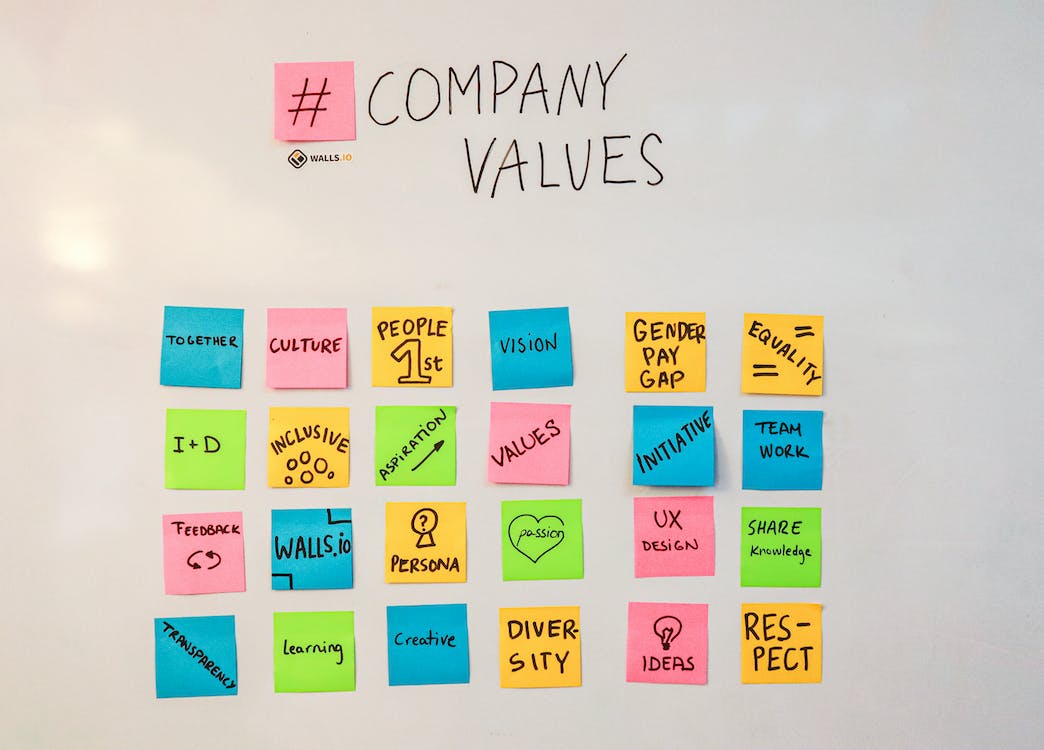Ein Mitarbeiter kommt immer wieder zu spät, eine Kollegin wird regelmäßig laut, eine Führungskraft ignoriert systematisch Rückmeldungen. Und dann sind da noch die Fälle über die niemand spricht: unangemessener Ton, Mobbing, Machtmissbrauch und verdeckte Diskriminierung.
Fehlverhalten in Unternehmen hat viele Gesichter und fast alle sind unangenehm. Für Betroffene, für HR und für die Führungskräfte.
Denn Fehlverhalten stellt nicht nur Regeln infrage, sondern auch die Beziehungen. Es betrifft nicht nur einzelne Personen, sondern auch die Unternehmenskultur. Es ist selten eindeutig, sondern ein Graubereich zwischen subjektivem Empfinden, rechtlicher Bewertung und Verantwortung.
Zeit, dieses Tabuthema offen zu beleuchten.
Was genau ist Fehlverhalten?
Fehlverhalten lässt sich nicht immer klar definieren und genau das macht den Umgang so anspruchsvoll. Es kann gesetzeswidrig sein, gegen den Code of Conduct verstoßen oder einfach soziale Normen verletzen.
Typische Kategorien sind:
- Verhaltensbezogen: Unhöflichkeit, Respektlosigkeit, mangelnde Teamfähigkeit, Aggressivität, unsachliche Kommunikation
- Arbeitsorganisatorisch: regelmäßiges Zuspätkommen, Fristversäumnisse, unentschuldigtes Fehlen und die Missachtung von Prozessen
- Ethisch: Diskriminierung, Mobbing, Grenzüberschreitungen
- Rechtlich: Betrug, Diebstahl, Datenmissbrauch, Arbeitszeitbetrug, Korruption
Fehlverhalten ist nicht immer gleich ein Kündigungsgrund, aber immer ein Signal. Und genau hier liegt die Verantwortung von HR. Zu erkennen, zu differenzieren, zu handeln.
Warum wird Fehlverhalten oft ignoriert?
Es gibt viele Gründe, warum Fehlverhalten in Unternehmen oft nicht thematisiert wird:
- Unsicherheit: Was zählt überhaupt als Fehlverhalten? Wer beurteilt das?
- Angst vor Eskalation: Kritik oder Sanktionen könnten die Situation noch mehr verschärfen.
- Machtverhältnisse: Fehlverhalten durch Führungskräfte bleibt oft unbeachtet, sei es aus falsch verstandener Loyalität oder Angst vor Konsequenzen.
- Fehlende Prozesse: Es gibt keine klaren Regeln, keine Ansprechpartner, keine Konsequenzen.
- Kultur des Wegschauens: „So ist er halt.“ – Normalisierung statt Intervention
Die Folge: Vertrauensverlust. Nicht nur zwischen den Beteiligten, sondern auch gegenüber dem Unternehmen. Wenn Verhalten toleriert wird, das andere belastet, schadet das langfristig jeder Unternehmenskultur.
Die Rolle von HR: Zwischen Konfliktklärung und Kulturarbeit
HR ist meistens die erste Adresse, wenn sich Fehlverhalten häuft. Und gleichzeitig auch die letzte, die eingreifen kann, wenn die Führungskräfte nicht mitziehen.
Die Herausforderung dabei ist, dass HR neutral, konsequent und empathisch agieren sollte. Zugegebenermaßen keine leichte Aufgabe, aber eine entscheidende.
Diese 3 Spannungsfelder prägen die HR-Arbeit bei Fehlverhalten:
- Aufklärung vs. Schweigekultur
Wie schafft man es Fehlverhalten sichtbar zu machen?
- Konsequenz vs. Vertrauen
Wie können Regeln durchgesetzt werden ohne eine Angstkultur zu erzeugen?
- Einzelfall vs. Systemfrage
Wann ist ein Verhalten individuell und wann ein Symptom struktureller Probleme?
Code of Conduct: Vom Dokument zur gelebten Kultur
Ein zentrales Instrument für den Umgang mit Fehlverhalten ist der Code of Conduct. Ein verbindlicher Verhaltenskodex für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Doch in einigen Unternehmen bleibt er zu abstrakt, zu juristisch und viel zu weit weg vom Alltag.
Was ein guter Code of Conduct leisten sollte:
- Klarheit schaffen: Was erwarten wir voneinander? Besonders im Ton, in der Haltung, im Verhalten?
- Orientierung bieten: Was tun bei Grauzonen? Wo kann ich mich melden?
- Verantwortung einfordern: Nicht nur HR, auch jede Führungskraft trägt Kulturverantwortung.
- Konsequenzen benennen: Transparenz darüber, was passiert, wenn Regeln verletzt werden.
Ein Code of Conduct wirkt nur dann, wenn er nicht nur unterschrieben, sondern auch verstanden und reflektiert wird.
7 konkrete HR-Ansätze im Umgang mit Fehlverhalten
- Fehlverhalten definieren und kommunizieren
Viele Konflikte entstehen, weil es kein gemeinsames Verständnis gibt, was genau akzeptables Verhalten ist. HR sollte gemeinsam mit der Geschäftsleitung verbindliche Verhaltensstandards definieren und kommunizieren.
- Anlaufstellen schaffen
Nicht jede Grenzüberschreitung braucht gleich ein offizielles Verfahren. Aber sie braucht ein offenes Ohr. HR sollte niederschwellige Gesprächsangebote schaffen, die auch anonymes Feedback ermöglichen.
- Frühzeitig eingreifen, nicht erst wenn es eskaliert
Oft wird Fehlverhalten erst thematisiert, wenn es bereits eskaliert ist. Dabei ist der Schlüssel die Früherkennung. HR und Führungskräfte sollten eng zusammenarbeiten, um Auffälligkeiten vorsichtig anzusprechen, bevor sie Schäden anrichten.
- Exit-Gespräche ernst nehmen
Fehlverhalten ist oft ein Kündigungsgrund. Ob direkt oder indirekt. Wer geht, tut das nicht selten wegen Team-Konflikten, Führungskultur oder mangelnden Schutz. Exit-Gespräche sind deshalb eine wertvolle Quelle, um wiederkehrende Muster zu erkennen.
- HR als Vermittler, nicht als Richter
HR ist keine Disziplinarinstanz, sondern ein Vermittler zwischen den Beteiligten. Wichtig ist es, Sachverhalte sorgfältig zu prüfen, Perspektiven einzubeziehen und lösungsorientiert zu handeln. Ohne Parteiergreifung.
- Vertrauen sichern und Transparenz schaffen
Der Balanceakt: Betroffene müssen sich sicher fühlen und gleichzeitig braucht das Umfeld Transparenz, dass Fehlverhalten nicht folgenlos bleibt. HR muss gut kommunizieren, ohne dabei Details offenzulegen.
- Konsequenz ermöglichen
Tabus beginnen auch oben. Wenn Führungskräfte Fehlverhalten zeigen oder es decken, ist HR besonders gefordert. Hier braucht es Rückhalt aus der Geschäftsleitung und klare Eskalationswege.
Das könnte Sie auch interessieren: Konfliktmanagement – Was muss, das muss!
Die besondere Verantwortung der Führung
Fehlverhalten ist nicht nur ein HR-Thema, sondern ein Führungsauftrag. Führungskräfte prägen durch ihr Verhalten, wie mit Fehlern, Reibungen und Grenzen umgegangen wird.
Sie entscheiden durch:
- Vorbildfunktion: Was vorgelebt wird, wird geduldet.
- Reaktion auf Beschwerden: Wird gehört oder ignoriert?
- Umgang mit Fehlern: Wird sanktioniert oder reflektiert?
HR sollte hier nicht nur reagieren, sondern aktiv entwickeln. Mit Coachings, Trainings und Feedbackformate, die auf Haltung und Beziehungskompetenz setzen.
Was tun bei Fehlverhalten in hybriden Teams?
In virtuellen oder hybriden Arbeitsmodellen wird Fehlverhalten schwerer sichtbar und lässt sich gleichzeitig leichter verbergen. Hier ist HR besonders gefragt, neue Beobachtungs- und Kommunikationsformate zu schaffen:
- Regelmäßige digitale Check-ins
- Anonyme Kurzbefragungen zum Teamklima
- Vertrauensbasierte „Buddy-Systeme“
- Klar definierte Umgangsformen für digitale Kommunikation
Was tun, wenn HR selbst betroffen ist?
Ein unterschätztes Thema, denn auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im HR erleben Fehlverhalten, sei es durch Führungskräfte, Kolleginnen und Kollegen oder im Beratungsprozess selbst.
Hier braucht es Schutzmechanismen:
- Externe Supervision
- Interne Eskalationsstufe außerhalb der Linie
- Kollegiale Beratung im schwierigen Fall
Zwischen Fairness und Klarheit: Was HR nicht tun sollte
❌ Probleme relativieren: „Das war sicher nicht so gemeint.“
❌ Betroffene mit Verantwortung belasten: „Warum haben Sie nicht eher was gesagt?“
❌ Alles intern halten wollen, obwohl externe Hilfe nötig wäre
❌ Führung schonen, weil sie unverzichtbar ist
❌ Zu lange zögern und damit das Vertrauen verspielen
Fazit: Fehlverhalten benennen heißt Verantwortung übernehmen
Wie ein Unternehmen mit Konflikten, Grenzüberschreitungen und Kritik umgeht, zeigt wofür es wirklich steht. HR nimmt hier eine Schlüsselrolle ein.
Gerade in Zeiten von Wertewandel, hybrider Zusammenarbeit und wachsender Sensibilität wird der professionelle Umgang mit Fehlverhalten zur echten Visitenkarte der Unternehmenskultur. Wer hier klar, empathisch und strukturiert agiert, stärkt nicht nur das Miteinander, sondern auch das Vertrauen in das Unternehmen.